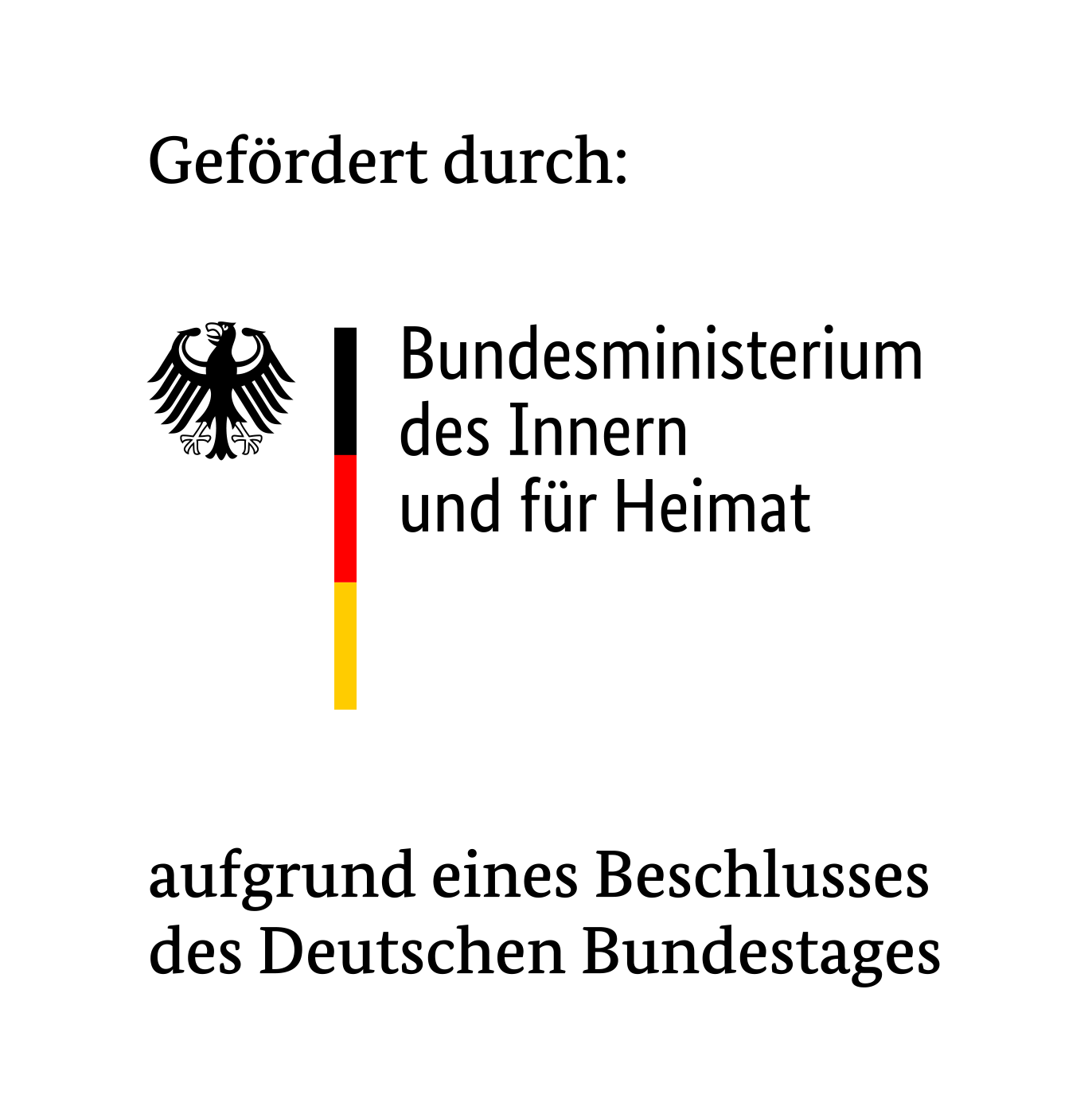Die erste Moschee, die in der Bundesrepublik Deutschland, also nach dem Zweiten Weltkrieg, erbaut wurde, war die Fazle Omar Moschee in Hamburg-Stellingen.
Sie ist nach der wegen Baufälligkeit abgerissenen Wünsdorfer Moschee und der Moschee in Berlin-Wilmersdorf die drittälteste Moschee im Gebiet des heutigen Deutschland und die zweitälteste noch bestehende.
Wie in Berlin war es eine Initiative der Ahmadiyya-Bewegung, die den Moscheebau voranbrachte. In Hamburg war es nicht die Lahore-Ahmadiyya („Ahmadiyya Anjuman Isha’at-i-Islam Lahore“ – AAIIL), sondern die weit größere Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ), die die Moschee erbaute.
Die beiden Zweige der Ahmadiyya unterscheiden sich in der Interpretation der Rolle des Gründers der Bewegung Mirza Ghulam Ahmed (1835 –1908). Die AMJ sieht den Gründer als Propheten an, was die AAIIL ablehnt.
Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Moschee am 22. Juni 1957 war die Fazle Omar Moschee einer der wenigen Orte in Hamburg, an dem sich Muslim:innen zum Gebet treffen konnten. Sie wurde daher in den ersten Jahren von unterschiedlichen muslimischen Gruppen zum Gebet genutzt.
Außer ihr gab es nur private Räumlichkeiten, in denen man sich zum Gebet traf und Räume der muslimischen Studierenden, Anfang der 50er Jahre in der theologischen Fakultät, später in der Bornstr. 16a.
Dies ändert sich im Laufe der 60er und 70er Jahre, als weitere Moscheen entstehen.
Das Jahr 1974 brachte einen weiteren Umbruch für die Gemeinde. In einer unter dem Vorsitz des saudi-arabischen Justizministers einberufenen Konferenz in Mekka, wurde unter Beteiligung von Repräsentanten aller Rechtsschulen und zahlreicher muslimischer Organisationen die Ahmadiyya (AMJ) am 10. Mai 1974 aus der Gemeinschaft des Weltislam ausgeschlossen. Parallel wurde die Gemeinschaft in Pakistan verboten und litt stark unter Repressionen.
Zahlreiche Ahmadis fanden im Anschluss Zuflucht in Deutschland, so dass die Gemeinde in Hamburg weiterwuchs. Heute zählt die AMJ laut eigenen Angaben (eigener Website) bundesweit rund 40.000 Mitglieder in 225 Ortsverbänden und unterhält rund 50 Moscheen. Sie repräsentiert damit rund 0,6 % der Muslim:innen, aber fast 15% der als Moscheen erkennbaren Gebetshäuser. Schätzungen gehen von 2.800 Gebetsräumen in Deutschland aus, von denen allerdings nur ca. 350 auch architektonisch als Moschee erkennbar sind.
2013 war ein weiteres bedeutendes Jahr für die AMJ, da sie zunächst in Hessen, später auch in Hamburg als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt wurde und somit als Religionsgemeinschaft rechtlich den christlichen Kirchen gleichgestellt ist.
Eine der juristischen Kategorien, die bei der Anerkennung von Religionsgemeinschaften als Körperschaft eine Rolle spielen, ist, dass sie „auf Dauer und auf Repräsentation” ausgerichtet sind.
Der Bau der Fazle Omar Moschee und ihre über 65-jährige Geschichte ist daher ein erster wichtiger Beleg für die Präsenz und dauerhafte Aktivität der AMJ in der Bundesrepublik Deutschland.
Zum Weiterhören:
Die Ahmadiyya Muslim Jamaat: Bald 100 Jahre Islam in Deutschland Sendung vom 09.10.22 bei swr2 Glauben
Zum Weiterlesen:
Selbstdarstellung der Ahmadiyya Deutschland: https://ahmadiyya.de/ahmadiyya/einfuehrung/
Burkhard Schäfers Ahmadiyya in Deutschland „Liberal und offen, aber wertkonservativ“
https://www.deutschlandfunk.de/ahmadiyya-in-deutschland-liberal-und-offen-aber-100.html Artikel auf Deutschlandfunk.de 23.07.2017
Burkhard Schäfers, Ahmadiyya in Deutschland – Splittergruppe oder muslimische Elite? Artikel auf Deutschlandfunk.de 28.09.2016 https://www.deutschlandfunk.de/ahmadiyya-in-deutschland-splittergruppe-oder-muslimische-100.html
Bildnachweis:
Fotos der Fazle Omar Moschee. Fotograf Michael Pfaff (SmF)