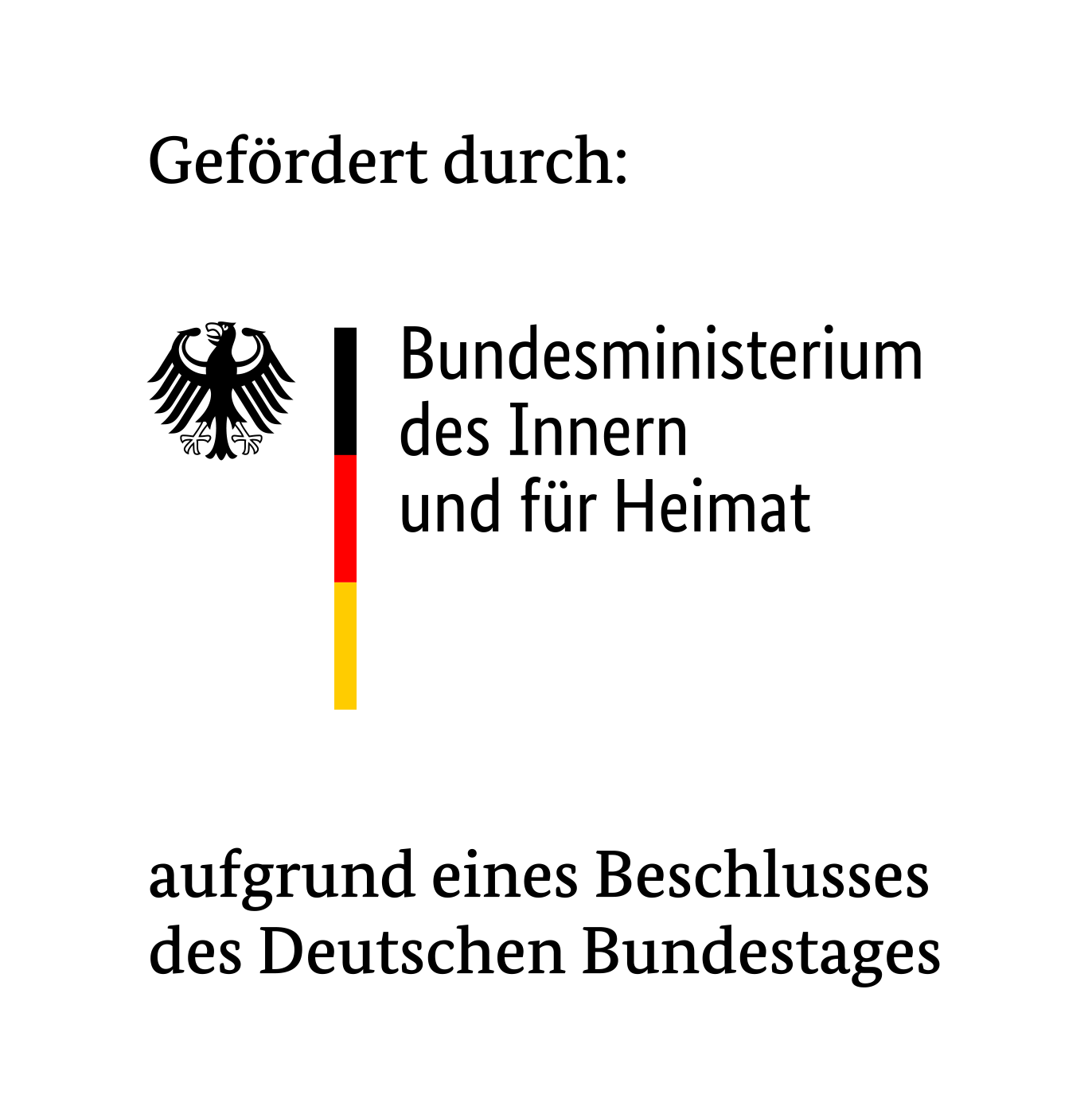Der türkische Volksmund kennt heute noch eine Bezeichnung für das Gewehr, das an die Zeit des osmanischen Kalifats erinnert: „Mauser”. Dieser Name einer deutschen Firma wurde zum Synonym für alle Gewehre, da vor dem ersten Weltkrieg rund zwei Drittel aller Gewehre des osmanischen Heeres von Mauser hergestellt wurden, in einer Fabrik im schwäbischen Oberndorf am Neckar.
Die Brüder Wilhelm und Peter-Paul Mauser entwickelten 1872 ein Gewehr für die Preußische Armee mit einer Kapazität von 10 Schuss. Sie erhielten für die Entwicklung der Waffe jedoch lediglich 8.000 Taler. Mit ergänzenden Aufträgen, etwa der Entwicklung eines Visiers und einem Großauftrag des württembergischen Heeres sind sie schließlich in der Lage die „Württembergische Gewehrfabrik” zu kaufen und zu erweitern. 1874 wird die Firma Mauser gegründet.
Im Rahmen der Zusammenarbeit des Deutschen Reiches mit dem Osmanischen Reich wird 1883 der preußische Generalmajor Colmar Freiherr von der Golz Militärberater des osmanischen Sultans.
Er unterrichtet an den Militärakademien, reformiert den Lehrplan und verfasst über 4000 Seiten an Lehrbüchern in türkischer Sprache. Er nutzt aber seinen Einfluss beim Sultan auch für seine Kontakte zur deutschen Waffenindustrie, vor allem den Firmen Krupp und Mauser. Es gelingt ihm, das Einkaufsmonopol, das zuvor in Händen armenischer Händler lag, zu brechen und 1887 einen Großauftrag mit Mauser einzufädeln.
Die Bestellung von 500.000 Repetiergewehren und 50.000 Kavalleriekarabinern waren der wirtschaftliche Durchbruch für Mauser. Nach Abwicklung des ersten Auftrags erfolgten weitere Bestellungen, Schon 1893 wurden weitere 200.000 Waffen bestellt. Und zwanzig Jahre später belief sich der Bestand des osmanischen Heeres auf über eine Million Mauser Gewehre.
Die Dividende des Unternehmens entwickelte sich entsprechend von 4% im Jahre 1879 auf 10% 1882, und nach dem Türkeigeschäft von 12% 1887 auf 24% im Jahre 1896. Es handelte sich nach heutigen Maßstäben um ein Milliarden-Geschäft.
Um diesen Auftrag abzusichern und die Qualitätskontrolle der zu liefernden Waffen zu gewährleisten, schickt die osmanische Armeeführung 19 Offiziere, die herzlich in Oberndorf empfangen werden. 1887 wird für sie der sogenannte Türkenbau errichtet, ein Gebäude in maurischem Stil, dessen Kuppel mit einem Halbmond geschmückt war. Hier residierte die Kommission.
Die Fabrikleitung lobte die hohe Kompetenz der Offiziere und auch im gesellschaftlichen Leben Oberndorfs waren sie geschätzte Gäste. Sie beeindruckten nicht nur durch ihr technisches Know-how, sondern auch durch ihre hohe Bildung und ihre Sprachkenntnisse. Viele Freundschaften zwischen Türken und Deutschen entstanden und mindestens drei der Offiziere heirateten deutsche Frauen.
Manche dieser Offiziere machten nach der Rückkehr ins Osmanische Reich beeindruckende Karrieren. Mahmud Schevket Pascha stieg zum Marschall, Großwesir, Außenminister und Kriegsminister auf. Er wurde zu einer der führenden Figuren der „Jungtürken”.
Moment mal! Jungtürken ?
Die Jungtürken waren eine politische Bewegung im Osmanischen Reich. Ziel war unter anderem eine konstitutionelle Monarchie und liberale Gesellschaftspolitik. Jungtürken standen von Anfang an in engem Austausch mit deutschen Intellektuellen. Während am Anfang ihre deutschen Kontakte eher unter Sozialdemokraten zu finden waren, gerieten sie immer mehr unter den Einfluss nationalistischer Ideologien.
Auch der nach ihm folgende Kriegsminister und spätere Großwesir Ahmed Izzet Pascha gehörte während seiner drei Jahre in Deutschland der Kommission in Oberndorf an. Ahmed Izzet Pascha soll ein großer Liebhaber klassischer westlicher Musik gewesen sein, so berichtet der spätere Präsident der Türkei Ismet Inönü in seinen Memoiren. So hat er vielleicht seine Liebe zu Mozart und Beethoven ja in Deutschland entdeckt oder zumindest vertieft.
Zwei Gräber auf dem 2018 eingeweihten muslimischen Gräberfeld Oberndorfs erzählen noch von dieser Zeit. Ibrahim Efendi, mit einer Frau aus Karlsruhe verheiratet, starb im Alter von 34 Jahren am 3. September 1888. Er wurde mit militärischem Geleit beerdigt. Die Grabrede hielt Hüseyin Hüsnü Efendi, der auf dem Grabstein folgendes Gedicht hinterließ:
Gott ist ewig
Hart ist das Unglück, zeugenlos in der Fremde zu sterben,
Getrennt von der Karawane, in fremder Erde zu bleiben.
Siehe den Hilflosen hier, von der Heimat Erde abgeschieden.
Doch hat der Schöpfer in diesem Boden seine Ruhestätte bestimmt.
Ewig sollen ihn Gattin und Kinder mit Sehnsucht beweinen.
Elend sind sie durch den Verlust und trauriger wurde ihr Schicksal.
Verkünden in stummer Andeutung soll sein Denkmal ewiglich:
Als Fremder in der Fremde, verlassen, bin ich hier geblieben.
Hüsnü, von Schmerz erfüllt, klagt mit diesem Gedenken.
Schade, hundertmal schade,
Der gute Ibrahim Efendi ist nicht mehr.
Das zweite Grab gehört Leyla Hüsnü, der neugeborenen Tochter von Hüseyin Hüsnü, die bereits mit 74 Tagen im Frühjahr 1889 verstorben ist. Auch Hüseyin war mit einer Deutschen verheiratet. Von seinem Sohn Ali wissen wir noch, dass er im ersten Weltkrieg ein berühmter Flieger in der osmanischen Luftwaffe war.
Der „Türkenbau” in Oberndorf selbst wurde 1961 abgerissen. Lediglich ein kleiner Gartenpavillon erinnert heute noch an ihn.
Die „Türkenzeit” hat jedoch auch Spuren im Brauchtum Oberndorfs hinterlassen. Als die osmanischen Offiziere ihre erste schwäbisch-alemannische Fasnacht erlebten, waren sie schockiert, dass die „Narren” bei ihren Umzügen mit Brot warfen und nicht alles Brot vom Publikum gefangen wurde. Die frommen Muslime empfanden es als eine große Sünde, so mit einem wertvollen Lebensmittel umzugehen und besorgten umgehend Orangen, die zu dieser Zeit in Oberndorf noch weitgehend unbekannt waren.
Ihr Gedanke war, dass die Frucht, durch die Schale geschützt, auch wenn sie auf die Straße fallen würde, bedenkenlos gegessen werden kann.
Heute noch verteilen die Oberndorfer „Schantle” zur Fasnacht Orangen. Und so ist eine über 100-jährige Tradition der Oberndorfer Narrenzunft auch eine „muslimische Spur in Deutscher Heimat”.
Zum Weiterlesen:
Fahri Türk, Die deutsche Rüstungsindustrie in ihren Türkeigeschäften zwischen 1871 und 1914, Frankfurt am Main 2004
Fahri Türk, Deutsche Militärmissionen und ihre Rolle beim deutsch-türkischen Waffenhandel im Osmanischen Reich 1871-1914, Juni 2010 https://www.academia.edu/81030401/Deutsche_Milit%C3%A4rmissionen_und_ihre_Rolle_beim_deutsch_t%C3%BCrkischen_Waffenhandel_im_Osmanischen_Reich_1871_1914
Kussmann-Hochhalter, Andreas , Halbmond über Oberndorf – Der Fabrikant vom Neckar, der Sultan vom Bosporus und ihre Geschichte, hrsg. vom Museum im Schwedenbau, Oberndorf 2015
Kussmann-Hochhalter, Andreas , Multurelle Geschichte Oberndorfs
https://www.oberndorf.de/soziales/migration+und+integration/kulturelle+geschichte+oberndorfs
Landgraeber, Wolfgang, Deutsche Waffenexporte für den Völkermord: Mauser-Gewehre und Krupp-Kanonen im Einsatz beim Genozid osmanischer Streitkräfte an Armeniern (1895-1915)
https://rib-stardust.jimdo.com/deutsch/f%C3%A4lle/armenien-lf-deu/
Bildnachweis:
Der türkische Gartenpavillon in Oberndorf. Foto: Michael Pfaff, SmF e.V. (2022)