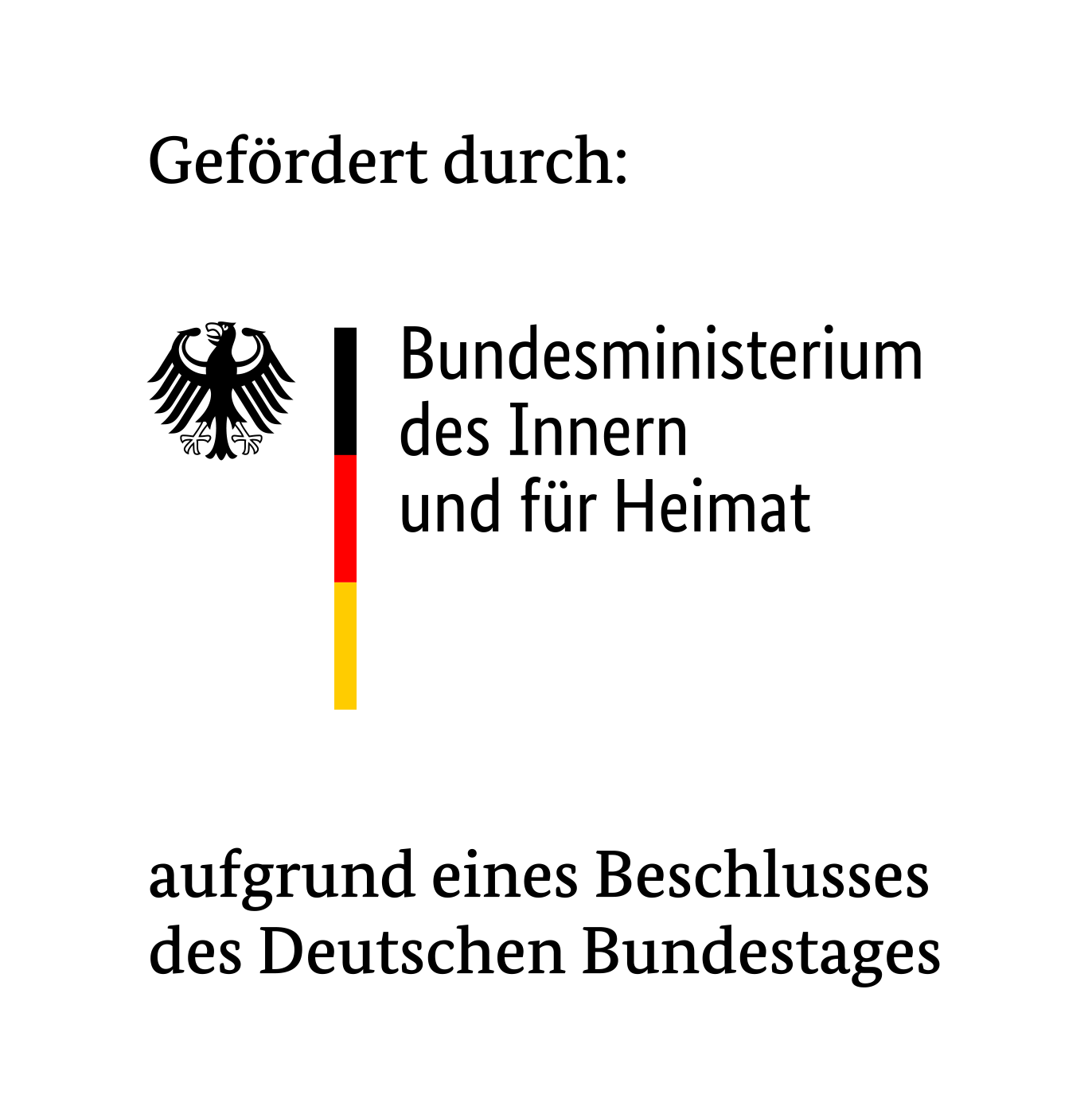Im Park des Schlosses Nymphenburg in München entdeckt man ein Gartenhaus, das bei genauerem Hinsehen an ein orientalisches Gebäude erinnert. Nähert man sich vom Schloss in südlicher Richtung dem sogenannten „Prinzengarten”, so steht dort das als “Hexenhäuschen” bezeichnete Gebäude. Das Gebäude ist aus Holz und auf der hinteren Seite hat man eine Mauer gemalt, von der mittlerweile der Putz abbröckelt. So hat man sich vielleicht das verwunschene Hexenhäuschen im Wald aus den Märchen vorgestellt. Der „Prinzengarten” war quasi der Spielplatz der Kinder des Kurfürsten. Das Gebäude wurde 1799 für den damals 12-jährigen Prinzen Ludwig, dem späteren König Ludwig I., errichtet.
Der Garten ist von Bäumen umgeben, eingezäunt, hat größere Rasenflächen und eine künstliche Felsenquelle sowie einen kleinen künstlich angelegten Bach. Erst wenn man den Garten betritt, sieht man den größeren Teil des „Gartensalettl”, des Gartenhäuschens, ein achteckiges Gebäude mit einer Kuppel, auf der eine mit einem goldenen Halbmond gekrönte Kugel thront.
Es handelt sich also weniger um ein Hexenhäuschen, als um einen orientalischen Köschk. Im Deutschen finden wir dieses Wort als Kiosk wieder.
Moment mal! Ein Kiosk war ursprünglich ein nach mehreren Seiten geöffneter freistehender Gartenpavillon in muslimischen Gartenanlagen und Palästen. Im 18. Und 19. Jahrhundert bezeichnete man so Pavillons in Gartenanlagen, die vor allem an Aussichtspunkten aufgebaut werden. Im 20. Jahrhundert wurde der Begriff dann angewandt für kleine Verkaufsstände in Form eines Häuschens oder einer Bude. Beliebt waren der Zeitungs- und Blumen-Kiosk, aber auch sogenannte Trinkhallen und Imbissbuden.
Wie kommt nun ein orientalisches Gebäude in den Park eines bayerischen Schlosses? Zunächst kann man feststellen, dass das Bayerische Fürstenhaus schon lange mit dem Orient zu tun hatte. Das Schloss Nymphenburg wurde anlässlich der Geburt des Thronfolgers Max Emanuel erbaut, der ab 1679 als Maximilian II. Kurfürst von Bayern wird. Maximilian erwarb sich militärischen Ruhm im „Großen Türkenkrieg” und erhielt aufgrund seiner blauen Uniform von den Osmanen den Ehrentitel „Mavi Kral” (der Blaue König).
Maximilian II. bringt auch Kriegsgefangene mit nach München. Rund 840 „Türken”, also Gefangene aus den osmanischen Gebieten, leben zwischen 1686 und 1699 in München. Dies entsprach damals einem Bevölkerungsanteil von über 8 %!
Türken arbeiten als Bauarbeiter, zum Beispiel für Maximilians Projekt, das Stadtschloss mit dem Schloss Nymphenburg über einen Kanal zu verbinden. Sie bereichern auch das Stadtbild als Sänftenträger. Ein großer Teil dieser Kriegsgefangenen kehrt nach dem Friedensschluss 1699 ins Osmanische Reich zurück. Ein Teil bleibt jedoch und ist teilweise sogar sehr erfolgreich.
So wird 1721 eines der ersten Kaffeehäuser, das „Café zum Türken”, im Stadtzentrum (Kaufingerstr. 7) von einem gebürtigen Türken eröffnet. Der unter dem Namen Josef Ferdinand Schönwein getaufte Türke lebte von 1689 bis zu seinem Tod 1723 in München, heiratete eine Deutsche und kam zu beträchtlichem Wohlstand.
Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts befinden wir uns in der Zeit des Absolutismus. Prunkvolle Kirchen und Paläste entstehen. Die Herrscherhäuser Europas befinden sich auf dem Höhepunkt ihrer weltlichen Macht. Nach dem Sieg über die Türken setzt eine „Türkenmode” ein. Man schmückt sich mit den Schätzen des Orients, hält höfische Feiern im Stile des Orients mit orientalischer Kleidung ab, orientalische Instrumente halten Einzug in die europäische Musik, man trinkt Kaffee und beginnt den Orient kennen zu lernen.
Die absolutistischen Herrscher sehen sich als die neuen Sultane und demonstrieren dies auch nach außen. Als der Bayerische Kurfürst ein Gebäude für seinen Sohn plant, liegt es daher nahe, ein Gebäude aus einem orientalischen Palast für den zukünftigen Herrscher zum Vorbild zu nehmen.
Ironischerweise kommt die Hoffnung auf absolute Macht eines Wittelsbachers, also der Familie Maximilians und seiner Nachfahren, etwas zu spät. Spätestens seit der Französischen Revolution 1789 ist die Zeit des Absolutismus vorbei.
Es gelingt den Wittelsbachern zwar 1806 die Königswürde zu erlangen. Als der Kronprinz aber als Ludwig I. 1825 den bayerischen Königsthron besteigt, muss er sich bald um den Ausgleich mit dem aufstrebenden Bürgertum bemühen.
Die Zeit orientalischer Prunkentfaltung von Fürstenhäusern ist vorbei. Der kulturelle Austausch mit dem Orient steht jedoch erst am Anfang.
Zum Weiterlesen:
Stefan Jakob Wimmer, München und der Orient, München 2012
Lena Griesbeck, Verwunschene Orte: Der Kronprinzengarten mit Pavillon im Nymphenburger Schlosspark auf Schlösserblog Bayern.de https://schloesserblog.bayern.de/allgemein/verwunschene-orte-der-kronprinzengarten-mit-pavillon-im-nymphenburger-schlosspark
Bildnachweis:
Prinzenhaus (Köschk) Schloss Nymphenburg, Foto: Michael Pfaff (SmF)