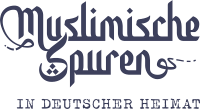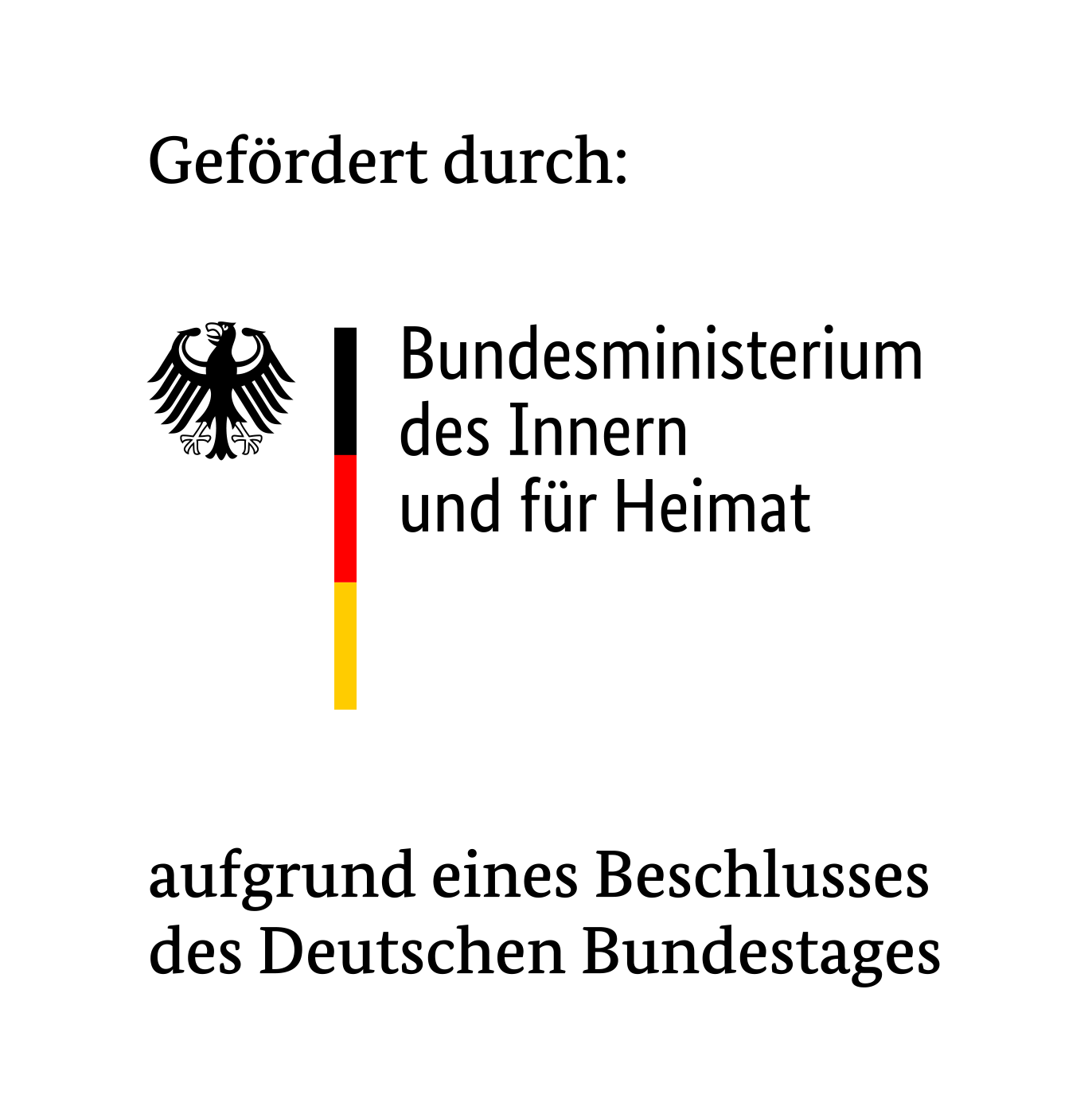Das Deutsche Wörterbuch der Gebrüder Grimm (entstanden 1838 bis 1961) bezeichnet Kaffee als „culturgeschenk des orients an den occident“.
Hat dies etwas mit dem Islam zu tun? Die ersten, die die belebende Wirkung des Kaffees für sich entdeckten und für die schnelle Ausbreitung des Getränks sorgten, waren jedenfalls muslimische Sufis, die ihre nächtlichen Gebete dank des Kaffees wacher verrichten konnten, ohne durch einen Rausch beeinträchtigt zu sein. Die muslimische Orthodoxie stand dem Kaffeegenuss jedoch meist kritisch gegenüber. Vor allem die Kaffeehäuser als Versammlungsort standen dabei im Fokus.
In den Kaffeehäusern versammelten sich Menschen, um Neuigkeiten auszutauschen oder sich zu unterhalten. Während Besucher miteinander plauderten oder sich mit Brettspielen beschäftigten, erhoben sich Dichter, Derwische oder Geistliche und trugen Gedichte, Geschichten oder Predigten vor. Es entstand ein anerkannter öffentlicher Raum außerhalb von Moscheen.
Es entstand also ein Raum, in dem jeder jeden ansprechen konnte und mit Allen Gespräche führen konnte. Dies schuf auch Raum für politische Gespräche. Kaffeehäuser hatten daher schon von Beginn an eine subversive Kraft und wurden von der Obrigkeit misstrauisch beäugt.
Das erste Kaffeehaus in Deutschland wurde 1673 von einem Holländer namens Jan van Huesden eröffnet. Er erhielt vom Bremer Senat die Erlaubnis für das Brauen und den Ausschank des damals wenig bekannten „außländischen indianischen (sic!) Getränkes“ im Gebäude des Schütting, dem Sitz der Kaufmannschaft. Bremen und Hamburg sind auch heute noch Sitz bedeutender Kaffeeunternehmen.
Das älteste heute noch bestehende Kaffeehaus Deutschlands ist das 1686 eröffnete „Cafe Prinzess“ (Rathausplatz 2) in Regensburg.
Neben den Kaffeehäusern, die auch in Europa eher Männern vorbehalten waren, erobert der Kaffee auch die Damenwelt. Ein 1715 erschienenes Wörterbuch kennt bereits den Begriff “Kaffeekränzchen”. Die Beliebtheit des Kaffees bei Damen wird von Johann Sebastian Bach in seiner Kaffeekantate aufs Korn genommen und 1734 im Leipziger Café Zimmermann uraufgeführt. Frauen treffen sich jedoch meist zu Hause in privaten Räumen und nicht in der Öffentlichkeit.
Kaffee wird sehr schnell Teil der Alltagskultur. 1785 schreibt beispielsweise Schiller: „Meine angenehmste Erholung ist bisher gewesen, Richters Caffeehaus zu besuchen, wo ich immer die halbe Welt Leipzigs beisammen finde und meine Bekanntschaften mit Einheimischen und Fremden erweitere.“
Dieses Zitat bringt uns zurück zum Kaffeehaus als neuen öffentlichen Raum. Die Möglichkeit sich in Kaffeehäusern auszutauschen hat eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Französischen Revolution (1789) und der Deutschen Revolution (1848) gespielt.
Das „Kulturgeschenk aus dem Orient“ war also nicht unerheblich an der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft in Europa beteiligt.
Gleichzeitig war den Europäer:innen die Herkunft des Getränkes stets bewusst. Kaffeehäuser waren häufig orientalisch ausgestattet und standen schon von Anfang an für ein kosmopolitisches Flair.
Im Laufe der Zeit erobern auch Frauen diesen öffentlichen Raum. So sind die Berliner Kaffeehäuser der 1920er Jahre auch Bühne für die Dichterin Else Lasker-Schüler, die als “Prinz Yusuf” gekleidet dort ihre Gedichte vorträgt.
Es gibt sowohl in orientalischen Ländern als auch in Deutschland unterschiedliche Varianten des Kaffeehauses. Das Traditionelle Kaffee, das einer Konditorei angeschlossen ist und die Tatlihane (Süßigkeitenhaus) seine orientalische Entsprechung dient eher Frauen, oder als Möglichkeit für beide Geschlechter sich unverbindlich zu treffen. Das klassische Bistro oder Kaffeehaus im “Wiener” Stil oder moderne Gastronomieketten sind Treffpunkte für Männer und Frauen. Kaffeehäuser in denen Karten oder Brettspiele gespielt werden, sind nach wie vor eher Treffpunkt von Männern.
Inzwischen ist Kaffee fester Bestandteil der Abendländischen Kultur. Kaffee dient in kleinen Porzellantassen als Symbol französischen savoir vivre oder italienischer Lebensart, als in Pappbechern serviertes Milchmixgetränk als Symbol des “American Way of Life” oder in Form von Filterkaffee als Symbol einer effektiven Leistungsgesellschaft.
Kaffee in seiner orientalischen Form (gewürzt mit Kardamom und Nelken) beginnt erst in den letzten Jahrzehnten auch in Europa wiederentdeckt zu werden.
Zum Weiterhören:
Noch mehr zum Thema Kaffee erzählt unser Podcast:
Kaffee Teil 1: Wie der Kaffee nach Europa kam https://anchor.fm/smf-verband/episodes/Kaffee-Teil-1—Wie-der-Kaffee-nach-Europa-kam-e185mdu
Und Kaffee Teil 2: Wie der Kaffee nach Deutschland kam https://anchor.fm/smf-verband/episodes/Kaffee-Teil-2—Wie-der-Kaffee-nach-Deutschland-kam-e19baif
Bildnachweis:
Café Prinzess Regensburg, Foto: Michael Pfaff