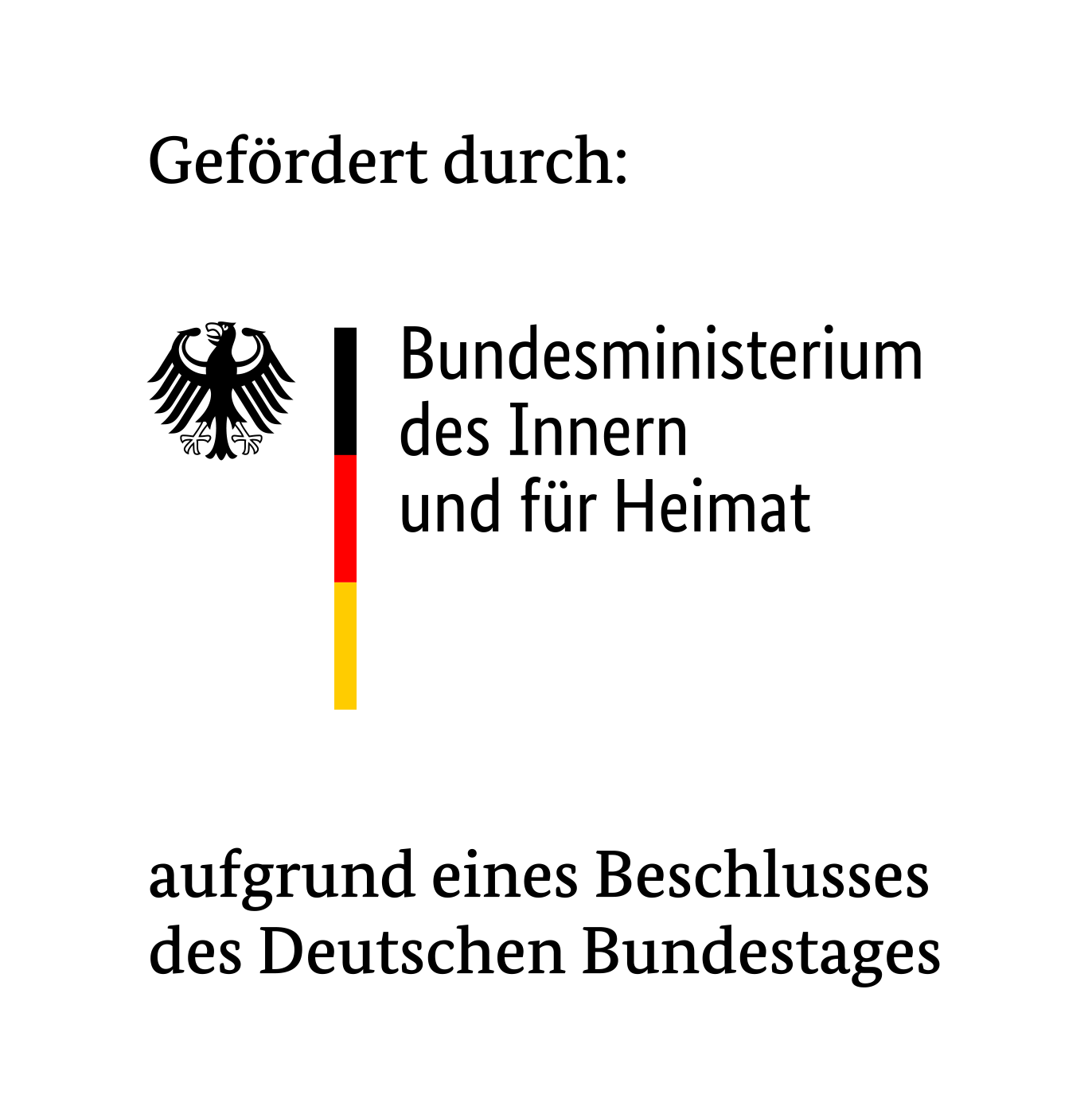Die 950 begonnenen diplomatischen Kontakte zwischen dem Heiligen Römischen Reich und dem Emirat von Cordoba, werden regelmäßig fortgesetzt.
Die nächste Diplomatische Mission wurde 962 von Cordoba anlässlich der Kaiserkrönung Ottos I. nach Rom geschickt. Leiter der Delegation war diesmal Ibrahim at-Tartuschi.
Über Ibrahim ibn Yakub at-Tartuschi selbst ist wenig bekannt. Sein Titel “At-Tartuschi” deutet auf seine Herkunft aus dem andalusischen Tortosa hin. Manche Quellen weisen auch die Namensergänzung “al Israili” auf, was auf eine jüdische Herkunft deuten würde. Welcher Religion er selbst angehörte, ist allerdings nicht ganz klar.
Er ist vor allem durch die Beschreibung seiner Reisen in das Abendland bekannt geworden, die zwar im Original nicht mehr erhalten sind, aber in zahlreichen Werken arabischer Gelehrter zitiert werden.
Seine Reisebeschreibungen sind seltene Beispiele, bei denen aus Sicht eines Besuchers aus dem Orient über Europa berichtet wird.
Nach dem Besuch der Kaiserkrönung in Rom begibt er sich im Auftrag des zweiten Kalifen von Cordoba Hakam II. (915 – 976) Anfang der 970er Jahre auf eine mehrjährige Reise nach Nord- und Zentraleuropa.
Der Bericht dieser Reise gilt beispielsweise als eine der besten Quellen über die Wikingerstadt Haithabu nahe dem heutigen Schleswig, die er als “reichste Stadt des Nordens” bezeichnet. Erhalten sind auch kurze Beschreibungen von Soest, Paderborn und Fulda.
Dokumentiert ist auch sein Besuch bei dem deutsch-römischen Kaiser Otto I. am 01.05.973 auf einem Hoftag in Merseburg.
Auf seinem Rückweg berichtet Ibrahim von einem Besuch eines Marktes in Mainz.
Erstaunt berichtet er von einem Fund arabischer Münzen. Es handelte sich um Münzen des Samaniden Nassr Ibn Ahmed aus Samarkand, die das Datum 301 und 302 der Hidschra (922 christl. Zeitrechnung) tragen. Er findet auch Waren, die er aus dem Orient kennt, wie Pfeffer, Ingwer und Nelken.
Abgesehen von diplomatischen Kontakten auf höchster Ebene scheint die Wirtschaft der damaligen Zeit schon viel “globalisierter” zu sein, als man denken würde. Ein Warenaustausch zwischen Orient und Okzident hat immer stattgefunden und mit diesen Waren fand manches Kulturgut bereits seinen Weg in deutsche Städte.
Leider führt der Austausch von Diplomaten im 10. Jahrhundert (noch) nicht zu einem intensiveren Dialog, oder einem Austausch von Informationen. Während seitens Andalusiens durchaus ein Interesse zu erkennen war, mehr über die “nördlichen Nachbarn” zu erfahren, war das deutsch-römische Reich wenig an diesem fernen Reich interessiert.
So bleiben viele Missverständnisse und Vorurteile noch lange erhalten, bis mehr Wissen über den Islam auch in deutsche Gebiete gelangt.
Zum Weiterlesen:
Jacob, Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10. Jahrhundert, Quellen zur deutschen Volkskunde 1, Berlin 1927. Im Internet unter: https://warburg.sas.ac.uk/pdf/nde5b2287023.pdf
Hunke, Sigrid, Allahs Sonne über dem Abendland, Stuttgart 1967. Im Internet unter: https://menadoc.bibliothek.uni-halle.de/inhouse-vgg/content/titleinfo/4896312
Weblinks:
Bildnachweis:
Public domain by wiki commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gewürze_Ägyptischer_Bazar.jpg
Stichworte/Glossar:
Samaniden
Die Samaniden waren eine persischstämmige Dynastie, die von 819 – 1005 über ein Reich herrschten, das weite Teile der heutigen Länder Afghanistan, Usbekistan, Turkmenistan und Iran umfasste. Sie unterstanden aber dem Kalifat der Abbasiden.